Teile diesen Beitrag "„Ich hab’s nicht verdient“: Vom Hochstapler-Syndrom befreien"
Text von: Romy Hausmann
„Gute Menschen denken immer zu gering von sich.“ – Der amerikanische Schriftsteller Nathaniel Hawthorne.
Mit 24 Jahren bekam ich das Angebot, eine Fernsehredaktion zu leiten. Nicht, weil ich gut gewesen wäre – Gott, bewahre – und man mir den Job ernsthaft zugetraut hätte – pfff, niemals. Es war Zufall. Pures Glück. Irgendwer muss die Stelle ja besetzen, dachte sich mein Chef, und ausgerechnet in diesem Moment rollte ich mit meinem Bürostuhl über den Gang, durch sein Sichtfeld und mitten rein in eine Idee: Die da soll’s machen, ist ja grad kein anderer hier.
Also leitete ich nun eine Redaktion. Hatte Redakteure unter mir, die zehn bis fünfzehn Jahre älter waren und um Welten erfahrener als ich. Ich verantwortete Sendungen, machte gute Quoten, strich von vielen Seiten Lob ein, bekam Angebote von der Konkurrenz, die auch gerne so eine Romy gehabt hätte, die so dekorativ über den Flur rollen konnte mit ihrem Bürostuhl. Ich nahm nichts an. Kein Lob, kein Angebot – selbst die Gehaltserhöhung fühlte sich irgendwie unverdient an.
Und warum?
Weil ich einfach nicht glauben konnte, dass ich wirklich, echt und ernsthaft einen guten Job machte. Ich hielt die Meinung der anderen über mich für einen Irrtum. Meine Karriere und mein angebliches Können für eine Lüge, die mir jederzeit um die Ohren fliegen konnte. Wenn ich mich mit Freunden traf, vermied ich es, über meine Arbeit zu sprechen. Ich wollte nicht, dass sie darüber staunten, an welche Orte mich meine Dreharbeiten geführt hatten, was ich erlebt hatte, welche Problem ich gelöst und was ich geleistet hatte (nämlich – gefühlt – absolut nüschts). Und wenn die Sprache doch darauf kam, dann hielt ich mich kurz. Jede Nachfrage hätte sich angefühlt, als wären sie mir auf die Schliche gekommen, und wüssten genau wie ich, dass alles eine Lüge war und ich eine einzige Mogelpackung.
Ich bin nicht gut, ich hatte einfach nur Glück…
Impostor-Syndrom nennt das die Psychologie, oder auch auf Deutsch: Hochstapler-Syndrom. Birgit Spinath, Professorin für Pädagogische Psychologie an der Universität Heidelberg, erklärt es folgendermaßen: „Wer unter dem Hochstapler-Syndrom leidet, hat ein Problem mit der Ursachenzuschreibung in seinem Leben. Betroffene vermuten, dass für die eigenen guten Leistungen nicht die eigenen Fähigkeiten verantwortlich sind, sondern Glück, nette Prüfer oder einfach Zufall. Sie zweifeln ständig an sich selbst und können Ängste entwickeln vor Prüfungen und anderen Situationen, in denen sie vermeintlich als Hochstapler enttarnt werden könnten.“
Heißt: Eigentlich war ich keine Lügnerin. Und natürlich konnte ich mehr als Bestzeit-Bürostuhl-Rennen fahren. Aber ich fühlte mich eben so – und litt. Um dieses drückende Gefühl irgendwie ruhig zu stellen, begann ich härter zu arbeiten, mehr Überstunden zu machen – Mittagspause? Ach Quatsch, gib mir einfach einen Liter Kaffee und ne Schachtel Kippen, läuft schon – wie um krampfhaft zu beweisen, dass ich irgendwie doch dieses Jobs würdig war. Wenn schon nicht wegen meiner Fähigkeiten, dann wenigstens, weil ich Einsatz zeigte. Damit gehörte ich zu den sogenannten „Over-Doern“, Menschen, die ackern bis zur Erschöpfung, die sich schlimmstenfalls das eigene metertiefe Loch graben bis hinein in die Depression.
Andere vermeintliche „Hochstapler“ versuchen über den Weg des „Under-Doing“ mit dem inneren Druck zurechtzukommen. Gar nichts mehr machen. Ausweglose Situationen schaffen, sich selbst sabotieren. Morgen früh um acht schreibst Du Dein Examen, egal, Du gehst trotzdem auf diese Party, tankst Dich so voll, dass es unmöglich ist, am nächsten Tag mit Leistung zu glänzen. Und alles nur, um Dir selbst zu bestätigen: Siehste, ich wusste es doch. Ich bin ein Versager oder eine Versagerin.
Wie man sich den inneren „Hochstapler“ einfängt…
Druck. Druck. Druck. Immer noch ein bisschen mehr. Mehr Kohle, mehr Quote, einer geht noch, kein Pausenknopf, keine Gelegenheit, den ergonomischen Bürostuhl mal kurz nach hinten zu kippen, mit verschränkten Armen hinter dem Kopf auszuruhen, sich über die eigene Leistung klarzuwerden. Keine Chefin, kein Chef, die sagen: „Hammer, was Du heute alles geschafft hat!“ Wenn überhaupt, dann wird gesagt, was als nächstes ansteht. Das neue große Projekt. Neue, noch höhere Erwartungen. Dazu vielleicht noch ein Elternhaus, das Erfolge in der Kindheit nicht ausreichend gewürdigt hat. Weil es ja irgendwie klar war, dass Kläuschen mit fünf Jahren das Seepferdchen gemacht hat. Seine Schwester konnte schließlich schon mit vier schwimmen. Weil die einzige Drei im Zeugnis die ganzen Einsen kaputt macht, und man hört: „Also, im neuen Schuljahr musst Du Dich in Mathe aber auch ein bisschen mehr anstrengen.“
„Einige Studien legen nahe, dass Frauen häufiger betroffen sein könnten als Männer“, sagt Birgit Spinath. „Ich finde diese Beobachtung plausibel, denn man weiß aus Untersuchungen, dass Frauen ihre Fähigkeiten häufig zu niedrig einschätzen. Generell sind oft Menschen betroffen, die in eine neue Lebenssituation und damit in eine neue Vergleichsgruppe geraten: am Beginn des Studiums, beim Übergang in den Job oder auch beim Aufstieg auf der Karriereleiter. Dann kommt der Gedanke hoch: Bisher ist ja alles gut gegangen, aber jetzt werde ich auffliegen.“
… und wie man ihn (annähernd) wieder loswird
„Der Weg ist das Ziel“ – den Ausspruch kennst Du bestimmt. Mir persönlich hat es geholfen, mich genau darauf zu konzentrieren. Mir Streckenmarken zu notieren in einer Art „Erfolgs-Tagebuch“. Sogar mikroskopische, fast lächerliche „Erfolge“. Nein, heute habe ich keinen großen Abschluss gemacht. Aber ich habe ein echt gutes Team-Meeting organisiert. Ideen gesammelt. Den Papier-Stapel bezwungen, der mit Kilimandscharo-Höhe in der Ablage schon länger darauf wartet, abgearbeitet zu werden. Ich habe die Kollegin für etwas gelobt, das sie gut gemacht hat, damit sie sich nicht ebenfalls irgendwann in dieser Spirale verheddert. All diese Dinge gebündelt schwarz auf weiß zu sehen, hat mein Gefühl sensibilisiert für die viele Arbeit, die ich wirklich in ein Projekt stecke. Für die zahlreichen kleinen, einzelnen Schritte, die ich jeden Tag tue – ich, nicht der Zufall oder das Glück.
Psychologin Spinath rät: „Wichtig ist es, Erfolge der Person selbst zuzuschreiben, also die eigenen Fähigkeiten zu loben oder die Anstrengung. Misserfolge dagegen sollten veränderbaren Ursachen zugeschrieben werden: weil man dieses Mal nicht gut vorbereitet oder die Aufgabe besonders schwierig war. Auch der genaue Sprachgebrauch ist entscheidend: Wünschen Sie vor einer Aufgabe „Viel Erfolg“ und nie „Viel Glück“!
Nein, Du bist keine Mogelpackung. Was Du Dir geschaffen hast, ist Dein Werk. Dein Einsatz, Deine Anstrengung. Du bist gut wie Du bist – trau Dich, stolz darauf zu sein.
Mehr unter Dein Selbstwertgefühl braucht Dich (eine Übung) und im myMONK-Buch für mehr echtes, tiefes Selbstwertgefühl.
Photo: Smiling woman von Darren Baker / Shutterstock














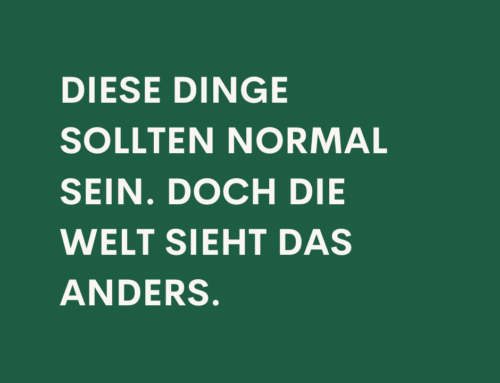










Toller Beitrag und absolut meine Situation. Ich bin nun 13 Jahre selbstständig und ich kann sagen, dass das nicht nur bei „Anfängen“ geschieht. Ich denke gerade wenn man etwas schon lange macht, verliert man den Anfang aus den Augen und damit auch das Verständnis, dass man sich selbst sehr lange sehr doll angestrengt hat.
Auch unsere Gesellschaft trägt dazu bei die perfekte Trugbilder erschafft. Personen die gefühlt tausend mal besser sind (später aber meist katastrophal enden).